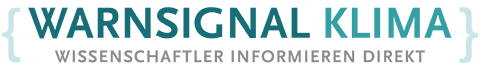Der Boden ist die belebte oberste Erdkruste. Er ist nach unten von festem oder lockerem Gestein, nach oben durch eine Vegetationsdecke bzw. die Atmosphäre begrenzt. Der Boden, die Pedosphäre, ist eingefügt zwischen Geosphäre, Biosphäre und Atmosphäre, wenige Zentimeter bis viele Meter dick, oft mit einer Schichtung, den Horizonten.
Ein Boden besteht aus Mineralien unterschiedlicher Art und Größe sowie aus organischen Stoffen, dem Humus, die alle in gewisser Weise geschichtet sind und das Bodengefüge mit Poren unterschiedlicher Größe bilden. Die Poren sind mehr oder weniger mit Bodenlösung (Wasser mit gelösten Stoffen und Gasen) und Bodenluft gefüllt.
Ein Boden weist Horizonte auf, die oben streuähnlich sind, nach unten gesteinsähnlicher werden. Kubiena (1950) hat mit zahlreichen farbigen Bodenprofilen einen auch heute noch grundlegenden Überblick über die Systematik der Bodentypen gegeben.
Die verschiedenen Bodentypen sind oft sehr charakteristisch für Ausgangsgestein, Klima und Vegetation (Breckle & Rafiqpoor 2019). Boden ist ein Naturkörper, bei dem Gestein unter einem bestimmten Klima und einer bestimmten streuliefernden Vegetation durch bodenbildende Prozesse (Verwitterung, Mineralienumbildung, Zersetzung, Humifizierung, Stoffverlagerung, Verdunstung) umgewandelt wird.
Bei Kulturböden kommt der Einfluss des Menschen dazu. Böden weisen sehr hohe Besiedlungsdichten mit Bakterien, Pilzen, Algen, Würmern und anderen Lebewesen auf (je m² etwa 10.000×10^9 Bakterien, 12×10^9 Pilze und 1×10^9 Algen). Ein Boden wirkt auch als Puffer gegenüber den verschiedensten Umweltweinflüssen.
Böden filtern z.B. Schadstoffe und ermöglichen so die Bildung sauberen Grundwassers, werden dabei allerdings selbst belastet. Böden bilden eine der wichtigsten Grundlagen für das terrestrische Leben. Sie gehören zu den kostbarsten und schützenswertesten Naturgütern der Menschheit. Dies ist durch die Bodencharta des Europarates bereits 1972 ausdrücklich festgehalten. In 12 Punkten wurde die lebenswichtige Bedeutung des Bodens für die Menschheit definiert und Richtlinien für den Schutz, die Bewirtschaftung und die Produktivitätssicherung bzw. -steigerung der Böden entwickelt.
Kulturböden dienen vor allem der Nahrungsmittelproduktion und der Erzeugung organischer Rohstoffe. Sie bilden aber auch die Grundlage wertvollen Grüns, das Menschen Erholung spendet, Freizeitaktivitäten ermöglicht und damit unserer Gesundheit dient. Die Ertragsleistung eines Bodens als Standort für Kulturpflanzen steht häufig nicht mit seiner Ertragsfähigkeit im Einklang, weil erstere durch zahlreiche nicht bodeneigene Faktoren wie Klima, Pflanzenart, Bodenbearbeitung, Düngung, Schädlingsbefall usw. beeinflusst wird.
So erbringen die sehr fruchtbaren ukrainischen Schwarzerden infolge ungünstigerer Klimabedingungen oft geringere Erträge als die weniger fruchtbaren, allerdings oft stark gedüngten Böden Mitteleuropas mit günstigeren klimatischen Voraussetzungen (Scheffer & Schachtschabel 2018). Klima, Böden und Vegetation sind eng miteinander verzahnt; dies erkennt man als Ergebnis auch an der organischen Bodensubstanz, dem Humus.
Er unterliegt vor allem der Aktivität der Bodenorganismen, die durch ihren Stoffwechsel laufend zum Auf-, Um- oder Abbau des Humus beitragen. Im eigentlichen Sinne ist nur der schon teilweise zersetzte organische
Anteil im Boden Humus, während der unzersetzte Anteil als Detritus bezeichnet wird. Humus und Detritus bestehen zu rund 50% aus Kohlenstoff.
Je höher der Anteil an organischem Material ist, desto mehr Regenwasser wird gespeichert. Vegetation und Boden als intaktes Ökosystem sind also ein Wasserspeicher. Das Wasser wird langsam von den Pflanzen aufgenommen oder sickert ins Grundwasser. Als Wasserfilter trägt der Boden so entscheidend zum Schutz des Grundwassers bei.
Die Nährstoffe können fast nur in Wasser gelöst von den Pflanzenwurzeln absorbiert werden. Organische Substanz im Boden, also Humus, bildet sich sehr langsam. Je nach Klima und Region sind viele Jahre nötig, damit einige Zentimeter Boden entstehen können. Boden ist daher ein knappes Gut. Böden können auch wie in der arktischen und subarktischen Region oder in Hochgebirgen zumindest zeitweise oder dauernd ab einer gewissen Tiefe (s.u. Permafrost) gefroren sein.
In den ariden und semiariden Regionen ist der Boden frei oder teilweise frei von Vegetation; er enthält daher nur wenig organisches Material. Wie Abb. 1.1-3 zeigt, kann sich aber auch in einer sehr trockenen sandigen Wüste wie in der Sechura-Wüste eine Vegetation entwickeln, wenn Wasser oder Regen ausreichend verfügbar ist, wie es während eines starken El-Niño-Ereignisses in Abständen von 3-5 Jahren der Fall ist. In der Namib-Wüste tritt dies noch seltener auf…
(mehr im Kap.1.1).